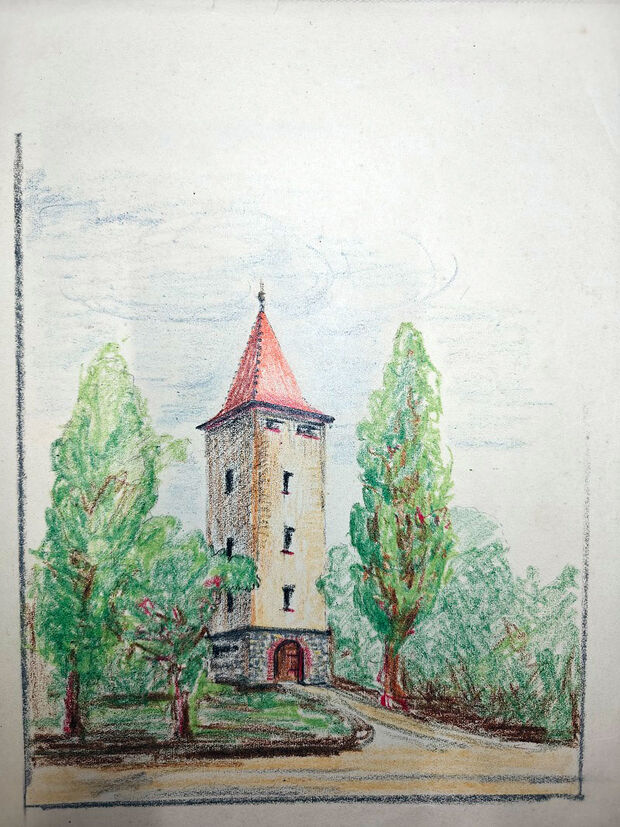Als Heimstätte des Saurierparks, Herstellungsort des Bautz’ner Senfs und Standort der Kulturerbestätte der Herrnhuter Brüdergemeine ist der Ortsteil Kleinwelka heute weit bekannt. Doch wie verlief die Entwicklung der ehemaligen Gemeinde in den vergangenen 200 Jahren? Für die Erforschung der spannenden Geschichte der Gemeinde Kleinwelka stehen im Archivverbund Bautzen ab sofort zusätzlich zu den bereits vorhandenen Unterlagen weitere Akten zur Verfügung, die im Jahr 2024 umfangreich erschlossen, das heißt für die Benutzung aufbereitet wurden.
Erste urkundliche Erwähnung 1318
Bereits 1318 wird der Ort erstmals urkundlich als „de Wolkowe“ erwähnt. Durch die Jahrhunderte wandelt sich der Ortsname von „Welkaw opetz“ (1419) über „kleynen Welcko“ (1504) allmählich zu „Klein Welcka“ (1791).
1747 erwarb der Verwalter des Rittergutes Teichnitz, Matthäus Lange, das Gut. Lange war ein Anhänger der Herrnhuter Bewegung und gewährte den erweckten Sorben, welche aus Teichnitz vertriebenen wurden, in Kleinwelka eine neue Heimstatt für die Diasporaarbeit. Die geistliche Erweckung der wendischen Landbevölkerung fand alsbald zahlreiche Anhänger.
Brüdergemeine verbindet Kleinwelka und Herrnhut
Als neuer und wachsender Ausgangspunkt der Brüdergemeine herrschte ab 1751 in Kleinwelka eine rege Bautätigkeit um dem wachsenden Zustrom Obdach zu geben. In der Folge entwickelten sich zwei kommunal eigenständige Ortsteile: „Dorf Kleinwelka“ bezogen auf das Rittergut sowie „Kolonie Kleinwelka“, welche die Siedlung der Herrnhuter Brüdergemeine umfasste.
Die Zugkraft der Brüdergemeine spiegelte sich auch in der über die Jahrhunderte stetig wachsenden Bevölkerungszahl wieder. Beschränkte sich diese 1777 noch auf 36 Personen, so wuchs sie bis 1925 auf 1033 Einwohner an. Durch die frühe Einrichtung von Internatsschulen für Missionarskinder in der Mitte des 18. Jahrhunderts, aus denen später die Knabenanstalt sowie das Mädchenschulheim hervorgingen, erlangte Kleinwelka erstmals überregionale Bekanntheit
Im Rahmen eines Bürgerentscheides sprachen sich die Bürger für eine Zusammenlegung der Ortsteile Dorf und Kolonie Kleinwelka aus, diese wurde zum 1. Juni 1932 umgesetzt.
In den nächsten Jahren erfolgte durch eine Neugliederung der Gemeinden 1936 die Eingemeindung der Orte Großwelka, Kleinseidau, Lubachau und Temritz zu Kleinwelka. Dieser Entwicklung folgend erweiterte sich die Gemeinde 1973 um Cölln und Milkwitz sowie 1994 um Salzenforst (mit Löschau, Nieder- und Oberuhna, Schmochtitz) und Bolbritz (mit Bloaschütz, Döberkitz).
Ende 1990er Jahre schließlich Ortsteil von Bautzen
Zum 1. Januar 1999 erfolgte die Eingemeindung nach Bautzen und die Umwidmung zum Ortsteil. In diesem Zuge gelangte das Verwaltungsschriftgut in die Zuständigkeit des Archivverbunds Bautzen. Hier wurden die als archivwürdig bewerteten Unterlagen in dem Bestand „64307 Rat der Gemeinde Kleinwelka“ erfasst. Eine weitere Übernahme von Unterlagen der Gemeinde Kleinwelka erfolgte 2023 durch eine Bestandsbereinigung des Kreisarchivs Bautzen.
Das Archivgut umfasst nun insgesamt 650 Verzeichnungseinheiten, die über die Internetseite Archivverbund Bautzen recherchierbar und im Lesesaal einsehbar sind.
Besonders hinzuweisen ist auf zwei sehr umfangreiche Aktenbände, die digitalisiert wurden und nun in digitaler Form über den heimischen Laptop einsehbar sind. Es handelt sich um zwei Chronikbände zur Geschichte von Salzenforst, die der Ortschaftsrat von Salzenforst/Bolbritz dem Archivverbund übergeben hatte. Die Digitalisate sind unter Archivverbund Bautzen einsehbar.
Durch die Bearbeitung stehen der Forschung nun zahlreiche Dokumente zur Ortsgeschichte Kleinwelkas im 19. und 20. Jahrhundert zur Verfügung und dienen dazu, den Ort, über die bekannten Punkte hinaus, neu kennenzulernen.